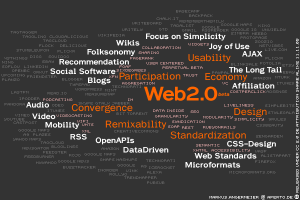Ab wann ist eine Veranstaltung öffentlich?
- Eine Veranstaltung ist immer öffentlich, wenn sie allgemein zugänglich Eine konkrete Zahl kann im Zusammenhang mit Bildveröffentlichungen nicht genannt werden – es kommt immer auf den Kontext des Bildes (und somit auf den Einzelfall) an.Siehe dazu den sehr informativen Beitrag der Rechtsanwaltskanzlei „DBJ“:
http://www.dbj.at/publications/vorsicht-bei-ver%C3%B6ffentlichung-von-event-fotos
Fazit:
„Vor der Veröffentlichung von Fotos von Personen sollte nach Möglichkeit deren Zustimmung eingeholt werden. Ist das im konkreten Fall nicht machbar, so ist bei der Wahl des Motivs (Person und Situation) sowie der Begleittexte Vorsicht geboten. Fotos „prominenter“ Personen bzw. Aufnahmen im öffentlichen Bereich sind grundsätzlich risikoärmer, aber auch hier gibt es Grenzen. Im Zweifel sollte daher die Wahl auf ein neutrales Foto fallen, denn ein Gerichtsverfahren erzeugt außer Kosten auch negative Publicity.“Was ist speziell im kirchlichen Bereich zu beachten?Daten (= auch Bilder) von Personen über ihre religiöse Überzeugung sind laut § 4 Z 2 DSG 2000 „sensible Daten“ und daher besonders schutzwürdig! Bilder also, die Personen bei der Ausübung einer religiösen Tätigkeit zeigen, können somit berechtigte schutzwürdige Geheimhaltungsinteressen verletzen -> die Zustimmung des Betroffenen zur Bildveröffentlichung ist daher auf jeden Fall einzuholen!Gemäß § 78 Urheberrechtsgesetz („Recht am eigenen Bild“) dürfen Bilder von Personen dann nicht veröffentlicht werden, wenn die Veröffentlichung berechtigte (schutzwürdige) Interessen des Abgebildeten verletzen würde. Das ist u.a. dann der Fall, wenn die Fotos für Werbezwecke (auch für pfarrliche Aktivitäten/Veranstaltungen) verwendet werden oder die Person in einem negativen Kontext darstellen („bloßstellen“). Die Judikatur hat bzgl. Bildveröffentlichungen allerdings eine Rechtsprechungswende vollzogen: demnach ist eine Fotoaufnahme, auf welcher der Abgebildete deutlich zu identifizieren ist, in der Regel nur mit Einwilligung des Abgebildeten zulässig – dies gilt dann wohl erst recht für die Veröffentlichung!
Generell gilt bei öffentlichen Veranstaltungen ein weniger strenger Maßstab als bei nicht öffentlichen Veranstaltungen (wer z.B. zu einer Kirchweihe geht, muss eher damit rechnen, dass er auf einem Foto dieser Feierlichkeit veröffentlicht wird, während die Teilnehmenden an einer Bibelrunde das wohl nicht müssen). Jedoch kann selbst die Veröffentlichung eines bei einer öffentlichen Veranstaltung entstandenen Fotos gegen berechtigte Interessen einer abgebildeten Person verstoßen (z.B. eine Person wird sichtlich betrunken beim Pfarrfasching fotografiert). Es empfiehlt sich also vor jeder Veröffentlichung zu überlegen, ob ein objektiver Grund gegen diese sprechen könnte, wobei im Zweifelsfall die Genehmigung der betroffenen Person einzuholen ist.Ist das Ziel eines Fotos, dass darauf bestimmte Personen (also nicht „die Menge“) abgebildet werden und werden in der Bildunterschrift unter Umständen auch noch deren Namen genannt (Gruppenfoto der Erstkommunionkinder, Firmlinge, etc.), ist vor der Veröffentlichung jedenfalls eine Zustimmung der Personen oder ihrer gesetzlichen Vertreter einzuholen.
Ausnahmen bestehen hinsichtlich Personen des öffentlichen Lebens (z.B. Mitglieder des PGR), welche grundsätzlich damit rechnen müssen, dass ihr öffentliches Handeln auch auf Fotos abgebildet und später veröffentlicht wird. Selbstverständlich dürfen aber auch in diesem Fall die Bilder nicht „wahllos“ veröffentlicht werden!
Die Veröffentlichung von Bildern, auf denen die Abgebildeten nicht oder nur sehr flüchtig erkennbar sind, bedürfen dagegen keiner Zustimmung der Abgebildeten – zumal wenn es sich, wie zuvor gesagt, um Abbildungen öffentlicher Veranstaltungen handelt (z.B. Foto vom Sommerfest der Pfarre).
Zuletzt sei noch auf Folgendes hingewiesen: das Veröffentlichen von Daten (Bildern) aus Datenanwendungen (also „gespeicherten“ Daten aus Archiven etc.) entspricht datenschutzrechtlich einer Übermittlung an die Öffentlichkeit, deren Zulässigkeit geprüft werden muss (-> Zustimmung des Betroffenen)!
Achtung: es ist immer auch die Zustimmung des (Bild-)Autors = Fotografen einzuholen!